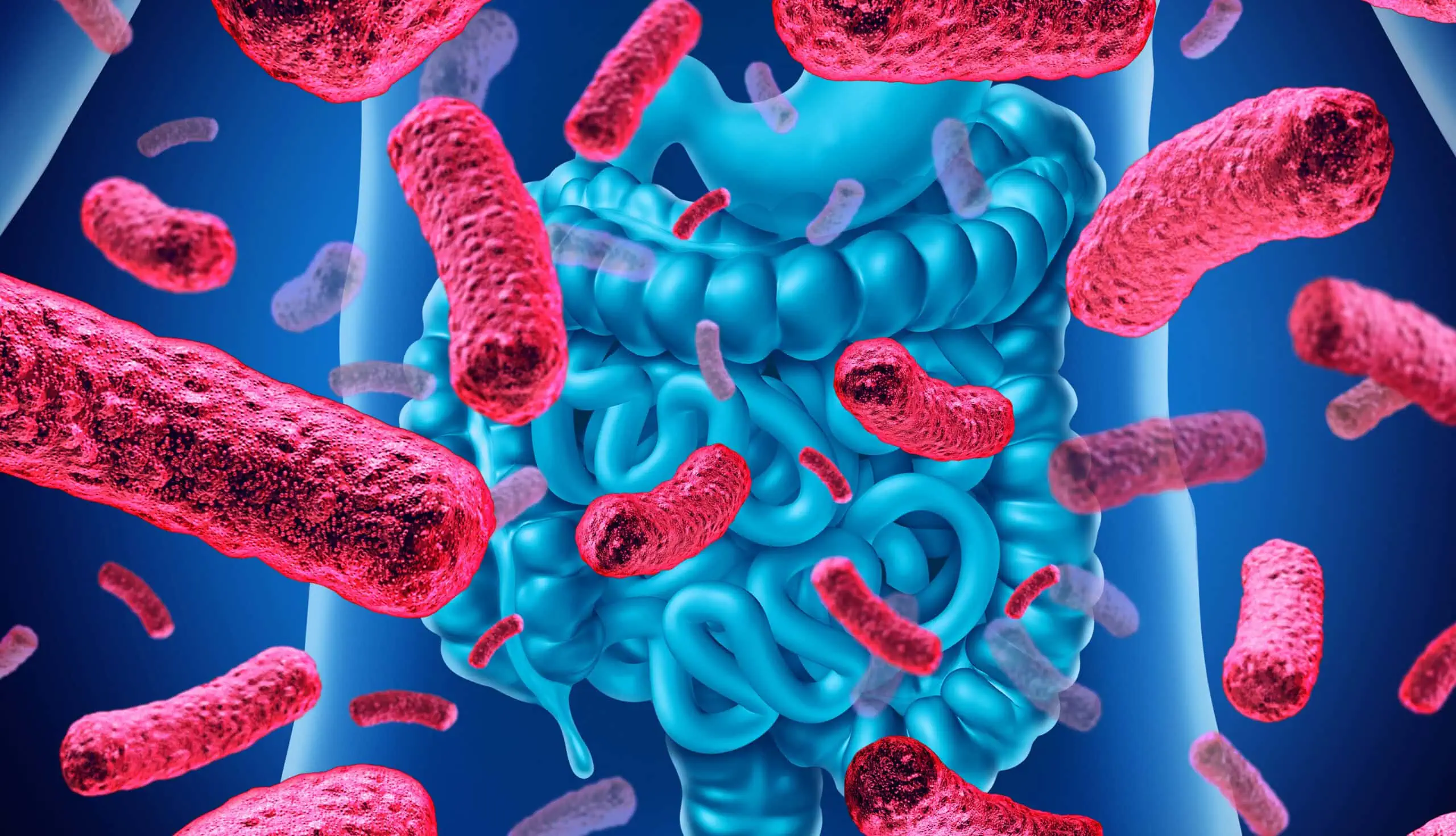Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
OUTBRAIN
Die Website verwendet die Technologie des Anbieters Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, UK („Outbrain“) mit der Sie auf weiterführende, für Sie ggf. ebenfalls interessante Inhalte innerhalb der Website und auf Websites von Dritten hingewiesen werden. Die von Outbrain z.B. unterhalb eines Artikels integrierten weiteren Lese-Empfehlungen werden auf Grundlage der bisherigen von Ihnen gelesenen Inhalte bestimmt. Für die Anzeige dieser interessenbezogenen weiterführenden Inhalte verwendet Outbrain Cookies, die auf dem Gerät des Nutzers gespeichert werden. Zudem werden die Cookies zur Auswertung und Unterstützung von Online-Marketing-Maßnahmen verwendet, um die Wirksamkeit der Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke zu erfassen. Somit kann erkannt werden, wie viele Websitebesucher auf eine Anzeige geklickt und abgeschlossen haben. Sowohl beim Retargeting als auch beim Abschluss Conversion Tracking erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten. Die im Outbrain-Widget angezeigten Inhalte werden inhaltlich und technisch von Outbrain automatisch gesteuert und ausgeliefert. Die Anzeige von Lese-Empfehlungen durch Outbrain mittels Cookies erfolgt auf rein pseudonymer Basis. Zur Anonymisierung der IP-Adresse wird der letzte Teil der IP-Adresse entfernt. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Outbrain finden Sie unter: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
Verarbeitendes Unternehmen
Outbrain UK Limited
5th Floor, The Place
175 High Holborn
London, WC1V 7AA, United Kingdom
Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.
• Marketing
• Analyse
• Internationale Datenübertragung
Genutzte Technologien
• Cookies
Erhobene Daten
• IP-Adresse
• Nutzerdaten
• Unique ID
• Browsertyp
• Nutzerzeit
• Besuchte Seiten
Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt.
• Art. 6 (1) (a) GDPR (Zustimmung)
Ort der Verarbeitung
USA und Europäische Union
Aufbewahrungsdauer
13 Monate
Datenempfänger
Outbrain UK Limited
Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.
PrivacyQuestions@outbrain.com
https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
https://www.outbrain.com/de/legal/privacy#amplify-terms-eu
AWIN
Wir arbeiten mit dem Affiliate- und Werbeunternehmen AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Deutschland) zusammen. Awin nutzt zur Ausführung ihrer Dienste auch Tracking-Tools, um eine Useraktion (etwa den Kauf eines Produktes) speichern und nachvollziehen zu können. Dadurch werden auch Daten von Ihnen in pseudonymisierter Form an das Unternehmen gesendet und dort gespeichert. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch AWIN finden Sie unter: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung
Verarbeitendes Unternehmen
AWIN AG
Landsberger Allee 104 BC
10249 Berlin, Deutschland
Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.
• Marketing
• Analyse
Genutzte Technologien
• Cookies
• Advertiser Journey-Tag
• Fingerprinting
Erhobene Daten
• IP-Adresse
• Nutzerdaten
• Unique ID
• Browsertyp & Gerätedaten
• Navigations- & Klickverhalten
Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt.
• Art. 6 (1) (a) GDPR (Zustimmung)
• Art. 6 (1) (f) GDPR (Berechtigtes Interesse)
Ort der Verarbeitung
USA & Europäische Union
Aufbewahrungsdauer
24 Monate
Datenempfänger
AWIN AG
Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens:
AWIN AG Datenschutzbeauftragte
Landsberger Allee 104 BC
10249 Berlin
Deutschland
Global-privacy@awin.com
GOOGLE CONVERSION LINKER
Wir verwenden den Google Conversion Linker, um Interaktionen auf dieser Webseite für einen längeren Zeitraum einer Interaktion mit einer Werbeanzeige über Google Ads und Google Marketing Platform zuzuordnen. Dadurch können Marketingkampagnen besser optimiert werden. Dadurch sollte der Nutzer als Ergebnis relevantere Anzeigen sehen.
Verarbeitendes Unternehmen
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.
• Marketing
Genutzte Technologie
• Conversion-verknüpfendes Skript
Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt.
• Art. 6 (1) (a) GDPR (Zustimmung)
Ort der Verarbeitung
Vereinigte Staaten von Amerika, Europäische Union
Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Daten werden nach 3 Monaten gelöscht
Datenempfänger
Google Ireland Limited
Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://safety.google/privacy/privacy-controls/
MICROSOFT CLARITY
Diese Webseite nutzt den Microsoft Dienst „Clarity“. Microsoft Clarity ermöglicht eine genauere Analyse des Nutzerverhalten bei der Benutzung dieser Webseite. Aus dem daraus gewonnen Protokoll lässt sich mögliche Verbesserungen ableiten. Hierzu werden die erhobenen Daten an Microsoft Clarity übermittelt und dort gespeichert. Die Nutzeranalyse basiert auf pseudonymisierten Nutzerdaten und trackt unter anderem Maus- und Scrollbewegungen auf dieser Webseite.
Die USA sind ein Land, das keinen im Sinne der EU-Verordnung 2016/679 angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet. Dies impliziert unter anderem, dass Regierungsbehörden in den USA möglicherweise das Recht haben, auf Ihre Daten zuzugreifen, ohne dass wirksame Abhilfemaßnahmen verfügbar sind.
Verarbeitendes Unternehmen
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.
• Marketing
• Analyse
• Internationale Datenübertragung
Genutzte Technologien
• Pixel-Tags
• Cookies
Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
• Zeitinformationen (z. B. Ereigniszeit)
• Seiten-Informationen (z. B. Land)
• Seiteninformationen (z. B. Seitentyp)
• Browserinformationen (z. B. Browserversion)
• Geräteinformationen (z. B. Werbe-ID)
• Verhaltensinformationen (z. B. Maus- und Scrollbewegungen)
Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt.
• Art. 6 (1) (a) GDPR (Zustimmung)
Ort der Verarbeitung
Vereinigte Staaten von Amerika, Europäische Union
Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden. Die Lebensdauer des Microsoft-Cookies beträgt bis zu einem Jahr. Sobald die Lebensdauer eines Cookies abgelaufen ist, löscht Ihr Browser es automatisch. Mehr über die Datenverarbeitung durch Microsoft erfahren Sie auf https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
TIKTOK
Wir verwenden die Dienste von TikTok, um Ihnen relevante interessenbasierte Werbung anzuzeigen. Daher teilen wir bestimmte Ihrer Interaktionen mit TikTok. Dadurch können wir Ihnen Dienstleistungen und Produktsortimente anbieten, die Sie interessieren könnten und Ihr Online-Erlebnis verbessern. Ihre Daten, die an TikTok weitergeleitet werden, helfen uns auch dabei, den Erfolg unserer Marketingaktivitäten zu messen und zu analysieren. Letztendlich werden die Anzeigen anhand dieser Daten gesteuert und zielgerichtet ausgespielt, um eine hohe Effizienz zu gewährleisten. Ihre Daten werden im Allgemeinen nach Irland (ein EU-Land), das Vereinigte Königreich (ein Land mit angemessenen Datenschutzstandards), Singapur und die USA übertragen und dort verarbeitet. Singapur und die USA sind Länder, die im Sinne der EU-Verordnung 2016/679 kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bieten; dies bedeutet unter anderem, dass Regierungsbehörden in diesen Ländern möglicherweise das Recht haben, auf Ihre Daten zuzugreifen, ohne dass wirksame Rechtsmittel verfügbar sind. Die letzendliche Muttergesellschaft von TikTok befindet sich in China, und wir können nicht ausschließen, dass einige personenbezogene Daten auch nach China übertragen und dort verarbeitet werden. China ist ein Land, das im Sinne der EU-Verordnung 2016/679 kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bietet; Es ist ein Land, in dem die Rechtsstaatlichkeit nicht streng angewandt wird und in dem eine umfassende staatliche Datenüberwachung und Profilerstellung herrscht. Dies bedeutet, dass Regierungsbehörden in China möglicherweise das Recht haben, auf Ihre Daten zuzugreifen, ohne dass wirksame Rechtsmittel verfügbar sind.
Verarbeitendes Unternehmen
TikTok Pte. Ltd.
Genutzte Technologien
• Server-zu-Server
Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.
• Marketing
• Analyse
• Targeting
Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
• Zeitinformationen (z. B. Ereigniszeit)
• Shop-Informationen (z. B. Land)
• Seiteninformationen (z. B. Seitentyp)
• Produktinformationen (z. B. Digital Barcode)
• Browserinformationen (z. B. Browserversion)
• Geräteinformationen (z. B. Werbe-ID)
• Kaufinformationen (z. B. Warenkorbwert)
• Marketinginformationen (z. B. Anzeigenklick-ID)
• Personenbezogene Daten (z. B. IP-Adresse, E-Mail-Adresse)
• Verhaltensdaten (z. B. Surfverhalten)
Rechtliche Grundlage
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt.
Art. Art. 6 Abs. 1 lit. a GDPR (Einwilligung).
Ort der Verarbeitung
Irland, Vereinigtes Königreich, Singapur, USA, möglicherweise China
Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden. Alle geteilten Daten werden von TikTok für 90 Tage gespeichert. Wir speichern einige Informationen über Ihre Interaktion mit unseren Anzeigen von TikTok für bis zu 3 Jahre.
KLAR ATTRIBUTION
Wir nutzen auf unserer Website die Dienstleistungen von Klar (Klar Insights GmbH, Marktstr. 18, 80802 München, Deutschland). Klar, erhebt, verarbeitet und speichert auf dieser Webseite und deren Unterseiten Daten zur Reichweitenmessung und statistischen Analyse in unserem Auftrag. Diese Erhebung erfolgt auf folgender Rechtsgrundlage: Liegt eine Einwilligung des Nutzers nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 a DSGVO und § 25 Abs. 1 Satz 1 TTDSG vor, werden die zu verarbeitenden Daten nutzerbezogen erhoben. Für die vorgenannten unterschiedlichen Erfassungsarten werden unterschiedliche Cookies eingesetzt, um die jeweilige Erfassungsart zu gewährleisten.
Cookie - Widerspruch
Um der Verwendung von Klar grundsätzlich zu widersprechen verwenden Sie bitte diesen Link. Dadurch wird ein Cookie mit dem Namen „do_not_track“ von der Domain „spiegel-der-gesundheit.de“ gesetzt. Bitte löschen Sie dieses nicht, da sonst nicht gewährleistet werden kann, dass Sie nicht durch Klar getrackt werden. Informationen zum Datenschutz und zur Datennutzung durch Klar können Sie der nachfolgenden Webseite entnehmen: https://www.getklar.com/data-protection
MICROSOFT ADVERTISING
Dies ist ein Tracking- und Werbedienst.
Verarbeitendes Unternehmen
Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland
Datenschutzbeauftragter des verarbeitenden Unternehmens
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.
https://aka.ms/privacyresponse
Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.
• Werbung
• Conversion Tracking
Genutzte Technologien
Diese Liste enthält alle Technologien, mit denen dieser Dienst Daten sammelt. Typische Technologien sind Cookies und Pixel, die im Browser platziert werden.
• Cookies
• Web beacons
• Gesammelte Daten
• Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
• Browser-Sprache
• Angeklickte Anzeigen
• Digitale Signatur
• GUID, die vom UET-Tag generiert wurde
• IP-Adresse
• Microsoft Klick-ID
• Microsoft Cookie
• Seitentitel
• Referrer URL
• Farbtiefe des Bildschirms
• Bildschirmauflösung
• UET-ID-Tag
• Ladezeit der Seite
• Zugriff auf Publisher/URL
Rechtliche Grundlage
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt
• Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
• § 25 Abs. 1 S. 1 TDDDG
Ort der Verarbeitung
Dies ist der primäre Ort, an dem die gesammelten Daten verarbeitet werden. Sollten die Daten auch in anderen Ländern verarbeitet werden, werden Sie gesondert informiert.
• Europäische Union
Dauer zum Speichern der Daten
Die Aufbewahrungsdauer ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Weitergabe an Drittländer
Bei in Inanspruchnahme dieser Dienstleistung können die gesammelten Daten in ein anderes Land weitergeleitet werden. Bitte beachten Sie, dass im Rahmen dieser Dienstleistung die Daten möglicherweise in ein Land übertragen werden, das nicht über die erforderlichen Datenschutznormen verfügt. Nachstehend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Weitere Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters oder wenden Sie sich unmittelbar an den Anbieter selbst.
• Weltweit
Datenempfänger
Im Folgenden werden die Empfänger der erhobenen Daten aufgelistet.
Microsoft Corporation
Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement
Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement
Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings
Speicherinformation
Unten sehen Sie die längste potenzielle Speicherdauer auf einem Gerät, die bei Verwendung der Cookie-Speichermethode und bei Verwendung anderer Methoden festgelegt wurde.
• Höchstgrenze für die Speicherung von Cookies: 1 Jahr, 25 Tage
GOOGLE ADS
Wir verwenden Google Ads, um gezielte und personalisierte Werbung bei Google und im Google-Werbenetzwerk zu zeigen. Der Inhalt der Anzeigen sollte dabei so relevant wie möglich sein. Um dies zu erreichen, teilen wir einige Ihrer Interaktionen auf dieser Webseite mit Google Ads. Dies schließt zum Beispiel die Informationen ein, dass der User eine spezifische Seite angesehen hat. Dadurch haben wir die Möglichkeit, den User über Google-Werbung mit Inhalten anzusprechen, die auf Deinen den Interaktionen basieren. Die USA sind ein Land, das keinen im Sinne der EU-Verordnung 2016/679 angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet. Dies impliziert unter anderem, dass Regierungsbehörden in den USA möglicherweise das Recht haben, auf Ihre Daten zuzugreifen, ohne dass wirksame Abhilfemaßnahmen verfügbar sind.
Verarbeitendes Unternehmen
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland
Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.
• Marketing
• Analyse
• Internationale Datenübertragung
Genutzte Technologien
• Pixel-Tags
• Cookies
Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
• Zeitinformationen (z. B. Ereigniszeit)
• Seiten-Informationen (z. B. Land)
• Seiteninformationen (z. B. Seitentyp)
• Browserinformationen (z. B. Browserversion)
• Geräteinformationen (z. B. Werbe-ID)
Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt.
• Art. 6 (1) (a) GDPR (Zustimmung)
Ort der Verarbeitung
Europäische Union
Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Lebensdauer der Google Ads-Cookies beträgt bis zu 2 Jahre. Sobald die Lebensdauer eines Cookies abgelaufen ist, löscht Dein Browser es automatisch. Alle gemeinsam genutzten Daten werden 9 Monate lang von Google Ads gespeichert. Wir speichern einige der Informationen in Bezug auf Ihre Interaktionen mit unserer Werbeanzeigen bei Google Ads bis zu 3 Jahre lang. Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://safety.google/privacy/privacy-controls/ & https://business.safety.google/privacy/
FACEBOOK PIXEL (META)
Wir nutzen die Dienste von Facebook, um Dir Werbung anzuzeigen. Wir möchten sicherstellen, dass diese Anzeigen für Dich so relevant wie möglich sind. Aus diesem Grund teilen wir einige Deiner Interaktionen mit Facebook. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Inhalt der Anzeigen auf Sie zugeschnitten ist. Zum Beispiel teilen wir Facebook die Informationen darüber mit, welche Produkte für Dich von Interesse waren, damit wir Produkte aus unserem Sortiment auf Facebook vorschlagen können, an denen Du möglicherweise auch interessiert bist. Die Daten, die an Facebook weitergeleitet werden, helfen uns auch dabei, den Erfolg unserer Marketingaktivitäten zu verfolgen und analysieren. Anhand dieser Informationen werden die Anzeigen optimiert, um eine hohe Effizienz zu gewährleisten. Wir und Facebook sind im Zusammenhang mit dem Einsatz dieser Technologie sog. gemeinsame Verantwortliche. Daher haben wir und Facebook einen Vertrag abgeschlossen, der diese Beziehung regelt. Wenn Du dazu Fragen hast oder Zugang zu den Daten möchtest, die durch diesen Service verarbeitet werden, wende Dich bitte Facebook, die sich um Deine Anfrage kümmern werden. Die USA sind ein Land, das keinen im Sinne der EU-Verordnung 2016/679 angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet. Dies impliziert unter anderem, dass Regierungsbehörden in den USA möglicherweise das Recht haben, auf Ihre Daten zuzugreifen, ohne dass wirksame Abhilfemaßnahmen verfügbar sind.
Verarbeitendes Unternehmen
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland
Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.
• Marketing
• Analyse
• Internationale Datenübertragung
Genutzte Technologien
• Cookies
• Server-zu-Server
Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
• Zeitinformationen (z. B. Ereigniszeit)
• Shop-Informationen (z. B. Land)
• Seiteninformationen (z. B. Seitentyp)
• Produktinformationen (z. B. Digital Barcode)
• Browserinformationen (z. B. Browserversion)
• Geräteinformationen (z. B. Werbe-ID)
• Kaufinformationen (z. B. Warenkorbwert)
• Marketinginformationen (z. B. Anzeigenklick-ID)
• Personenbezogene Daten (z. B. IP-Adresse, E-Mail-Adresse)
• Verhaltensdaten (z. B. Surfverhalten)
Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt.
• Art. 6 (1) (a) GDPR (Zustimmung)
Ort der Verarbeitung
USA und Irland / Europäische Union
Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Lebensdauer von Facebook Ads-Cookies beträgt bis zu 90 Tage. Sobald die Lebensdauer eines Cookies abgelaufen ist, löscht Ihr Browser es automatisch. Alle geteilten Daten werden bis zu 2 Jahre lang bei Facebook gespeichert. Wir speichern einige der Informationen in Bezug auf Ihre Interaktionen mit unserer Werbeanzeigen auf Facebook bis zu 3 Jahre lang.
Datenempfänger
• Facebook, Inc.
• Facebook Ireland Limited
Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.facebook.com/privacy/explanation
Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
TABOOLA
Auf der Website werden Cookies von Taboola verwendet. Mittels dieser Cookies können die Besucher der Website zielgerichtet mit Werbung angesprochen werden, indem für diese individualisierte Werbe-Anzeigen geschaltet werden. Hierzu wird eine kleine Datei mit einer Zahlenfolge in den Browsern der Besucher gespeichert. Über diese Zahl werden die Besucher der Website sowie anonymisierte Daten über die Nutzung der Website erfasst. Nachfolgend können Ihnen Werbeeinblendungen angezeigt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor aufgerufene Produkt- und Informationsbereiche berücksichtigen. Zudem kann der Anbieter die Cookies zur Auswertung und Unterstützung von Online-Marketing-Maßnahmen nutzen, um die Wirksamkeit der Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke zu erfassen. Somit kann erkannt werden, wie viele Websitebesucher auf eine Anzeige geklickt und abgeschlossen haben. Sowohl beim Retargeting als auch beim Abschluss Conversion Tracking erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten. Weiterführende Informationen finden Sie auf https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.
Verarbeitungsunternehmen
Taboola Germany GmbH
Alt-Moabit 2
10557 Berlin
Datenschutzinformationen der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.
dpo@taboola.com oder support@taboola.com.
Datenverarbeitungszwecke
Ausspielung von zielgerichteter Werbung und Messung der Werbewirksamkeit.
Erhobene Daten
• Technische oder für die Navigation erforderliche Informationen
• Informationen über das Betriebssystem
• Aufgerufene Webseiten
• Vorherige Website, von der Sie auf unsere Website gelangt sind
• Ereignisinformationen (z. B. unregelmäßige Systemabstürze)
• Allgemeine Standortinformationen (z. B. Stadt)
• Conversion Tracking
• IP-Adresse
• Unique-ID
Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt. Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).
Ort der Verarbeitung
Deutschland, UK, Israel, USA
Aufbewahrungsfrist
13 Monate
Datenempfänger
Taboola
Weitere Informationen
Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen und ggfs. weitere Auskünfte einzuholen. https://www.taboola.com/policies/privacy-policy
CRITEO
Wir verwenden Criteo, einen Analyse- und Werbedienst der Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankreich („Criteo“). Criteo setzt Cookies im Browser des Nutzers, um Trends zu analysieren und Nutzerinteressen zu identifizieren. Criteo verarbeitet die IP-Adresse des Nutzers aus Gründen der Betrugsprävention. Criteo arbeitet mit verschiedenen Plattformanbietern („Publishern“) zusammen, um unsere Anzeigen auf unterschiedlichen Webseiten zu schalten. Diese Publisher setzen möglicherweise ebenfalls Cookies im Browser des Nutzers. Weitere Informationen können der Datenschutzerklärung von Criteo unter https://www.criteo.com/de/privacy/ entnommen werden. Die Deaktivierung von Criteo kann über den Link https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/vorgenommen werden.